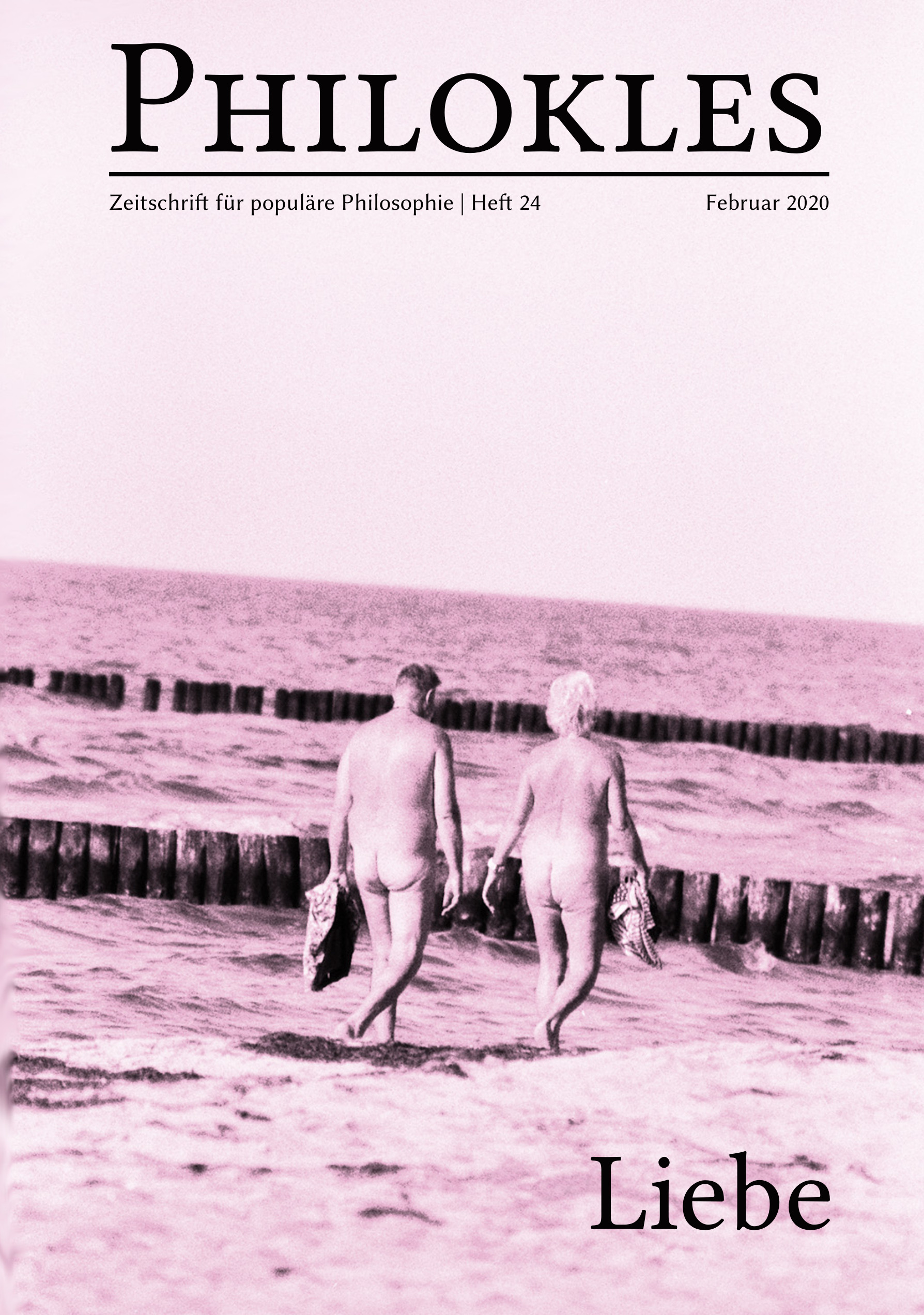Zeit 
Interview
Das Maß der Zeit. Peter Janich im Gespräch mit PHILOKLES über das richtige Verständnis von Zeit und die Rolle der Zeitmessung
Aufsätze
Wo ist die Zeit, bevor sie gemessen wird? Über das Verhältnis von Bewegung und Zeit bei Aristoteles (Michael Vogt)
Zeitallgemeinheit und Zeitlichkeit im Weltbezug und Weltverlauf. Überlegungen zum Zeitbegriff im Anschluss an Hegel (Pirmin Stekeler-Weithofer)
McTaggarts Irrealität der Zeit (Claudia Reich)
Das Wesen der Zeit (Nikos Psarros)
Zeit und (menschliche) Existenz (Andreas Luckner)
Rezension
Ursula Coopes Time for Aristotle (Michael Frey)
Leseprobe
Augustinus: Bekenntnisse, Elftes Buch (ausgewählt und vorgestellt von Peter Heuer)
Das Heft zum Download
Editorial
PHILOKLES erscheint diesmal nicht als Diskussionsheft. Vielmehr wurden fünf Aufsätze zusammengestellt, in denen es in vielfältiger Weise um ‚Zeit‘ geht. Auch wenn ‚Zeit‘ nicht an die ganz großen metaphysischen Themen, wie etwa Welt, Seele oder Gott heranreicht, ist sie doch ein wirkliches philosophisches Problem. Zeit, das lernen bereits Kinder, kann man nicht sehen und anfassen, aber irgendwie gibt es sie doch. Um sich ihrer zu vergewissern, muss man nachdenken, d. h. philosophieren. Zeit ist allgegenwärtig und so liegt es nahe, an ihrem Beispiel in die Seinsweise geistiger, abstrakter Gegenstände vorzudringen.
Über die Seinsweise abstrakter Gegenstände ist man sich innerhalb der Philosophie von jeher uneins. Es gibt drei prominente Positionen: den Nominalismus, den Realismus und den Konzeptualismus. Nominalisten meinen, abstrakte Gegenstände seien nicht real existent, sondern nur im menschlichen Bewusstsein vorhanden. Realisten vertreten die gegenteilige Position, sie behaupten eine vom Bewusstsein unabhängige Realexistenz abstrakter Gegenstände. Konzeptualisten versuchen, einen Mittelweg zu gehen.
Michael Vogt führt seine Leser in die Zeittheorie Aristoteles’ ein. Aristoteles vertritt eine konzeptualistische Position. Zeit hat für ihn einerseits eine der Bewegung physischer Körper nachfolgende Realexistenz, andererseits aber auch ein Sein im menschlichen Bewusstsein. Michael Vogt diskutiert eine Reihe möglicher Auflösungen dieser scheinbaren Paradoxie und gelangt zu der Ansicht, dass es sich dabei um zwei verschiedene Arten von Zeit handelt.
Pirmin Stekeler-Weithofer entwickelt seine Überlegungen mit Bezug auf Hegels Kritik an Kants Auffassung von Zeit. Kant leugnet die Realexistenz der Zeit und erklärt sie zu einer vom Subjekt an die Wahrnehmungssituation herangetragenen Form der Anschauung. Hegel zeige, so Stekeler-Weithofer, dass eine solche Auffassung ‚mystisch‘ sei. Stattdessen sei Zeit als reiner (Hegel’scher) Begriff aufzufassen. Auch für Hegel habe Zeit keine Realexistenz. Vielmehr sei sie ein Konzept, über welches die Sprechergemeinschaft immer schon verfüge und an dem der einzelne Sprecher Anteil habe.
Claudia Reich berichtet über die Zeittheorie McTaggarts, eines Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts. McTaggarts Überlegungen zur Zeit lassen sich dem Neukantianismus zurechnen und kulminieren in der These, Zeit sei irreal.
Nikos Psarros versucht sich dem Thema ‚Zeit‘ eigenständig zu nähern. Er entwickelt dafür eine neue Begrifflichkeit und vertritt die ungewöhn-liche These, Zeit sei – ähnlich den sogenannten Transzendentalien – eine analoge Kategorie, die in jedem Bereich des Seins eine wesentlich andere Bedeutung habe. Um seine These zu verteidigen, vergleicht er die spe-zifische Zeitlichkeit von Gedanken mit der des physischen Seins.
Andreas Luckner erarbeitet eine Phänomenologie unseres subjektiven Zeiterlebens. Fragen, die ihn dabei interessieren, sind: Wie ist es zu erklären, dass es uns im Rückblick nach einer Reise so vorkommt, als sei die Zeit langsamer vergangen als sonst, während sie uns unterwegs wie im Flug zu vergehen schien? Insbesondere finden auch die Phänomene Langeweile, Kurzweil, Stress und Muße sein besonderes Augenmerk.
Ergänzt wird das Heft durch ein Interview mit Peter Janich, einem der wichtigsten Vertreter des Konstruktivismus bzw. Kulturalismus. Deren Position versucht, die Gegenstände der Wissenschaften, unter ihnen die Zeit, in lebensweltlichen Praxen zu fundieren. Janich hat vor Jahren eine Protophysik der Zeit erarbeitet und antwortet vor diesem Hintergrund auf unsere Fragen.
Unsere Rezension befasst sich noch einmal mit Aristoteles’ Zeittheorie, sie bespricht Ursula Coopes Buch Time for Aristotle, einen in jüngster Zeit entstandenen Aristoteleskommentar.
Als Leseprobe werden Ausschnitte aus dem elften Buch der Bekenntnisse des Augustinus’ abgedruckt, in denen er seine Zeittheorie entwickelt. Sein besonderes Interesse gilt dem Verhältnis von Ewigkeit und Zeitlichkeit. Auch Augustinus vertritt eine aristotelische Zeitauffassung und arbeitet sie näher aus. Er meint, dass die Zeit zwar zusammen mit der Bewegung der irdischen Dinge geschöpft worden sei, aber erst dann Vollendung finde, wenn sie im menschlichen Bewusstsein gezählt und gemessen werde, d. h. zu ihrem wirklichen Sein gelange.
Die aristotelisch-augustinische Auffassung der Zeit motivierte auch die Auswahl des Titelbilds. Bei Sonnenuhren fällt bekanntlich der in Folge der Erdrotation wandernde Schatten auf eine von Menschen angefertigte Skala und misst so die Zeit. Auf diese Weise demonstrieren Sonnenuhren ein Zusammenspiel von kosmischer Bewegung und menschlicher Vernunft. Sonnenuhren sind zwar keine besonders genauen Zeitmesser, aber auf Grund ihrer Konstruktion wird das Geheimnis der Zeit, ein Zwitterwesen aus Natur und Geist zu sein, ein Stück weit sinnfällig. Dies ist bei anderen Arten von Uhren nicht in gleicher Weise der Fall.
Peter Heuer